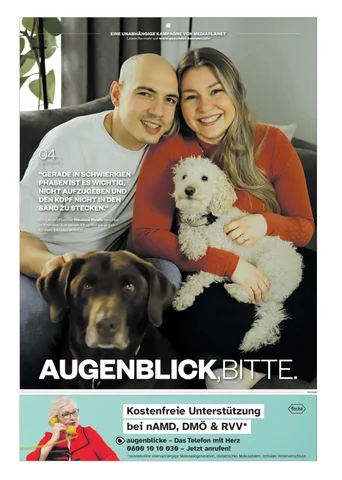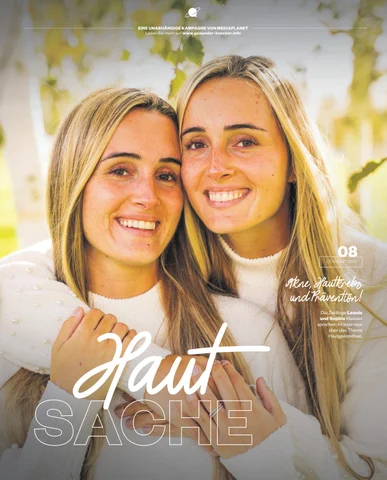„Barrierefreiheit beginnt im Kopf.“ Stefanie Freitag, Beraterin und Bezirksgruppenleiterin beim BBSB e. V. erzählt, warum Verständnis und Sensibilität genauso wichtig sind wie Gesetze – und wie wir alle dazu beitragen können, dass Inklusion im Alltag funktioniert.
DIE POLITIK MUSS KLARE REGELN MIT SPÜRBAREN SANKTIONEN SCHAFFEN, WENN BARRIEREFREIHEIT NICHT UMGESETZT WIRD – SONST BLEIBT SIE EIN LIPPENBEKENNTNIS.
Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz ist ein wichtiger Schritt in Richtung mehr Inklusion. Wie bewerten Sie die bisherigen Fortschritte, insbesondere im Hinblick auf digitale Angebote für blinde und sehbehinderte Menschen?
Ich sehe im Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) einen wichtigen Meilenstein: Er verpflichtet erstmals auch Bereiche der Privatwirtschaft wie Online-Shops, E-Books oder Bankdienstleistungen zur Barrierefreiheit – und damit bietet er uns blinden und sehbehinderten Menschen echte Perspektive auf mehr selbstbestimmte Teilhabe im digitalen Alltag. Gleichzeitig ist das Gesetz nur so stark wie seine Umsetzung: Ohne konsequente Marktüberwachung und Sanktionen bleibt Barrierefreiheit leider häufig Theorie.
Oft werden die Bedürfnisse von blinden Menschen stärker wahrgenommen als die von sehbehinderten. Welche spezifischen Herausforderungen erleben Menschen mit Sehbehinderung und warum stoßen sie häufig auf mehr Vorurteile?
Sehbehinderungen sind sehr individuell – je nach Erkrankung, Verlauf und Alltagssituation. Manche brauchen starke Kontraste und gute Beleuchtung, andere kommen ohne Hilfsmittel aus, nutzen aber dennoch einen Langstock. Für Außenstehende wirkt das oft widersprüchlich und führt zu Vorurteilen oder gar dem Verdacht, jemand würde seine Einschränkung „simulieren“.
Hinzu kommt, dass viele Betroffene technische Hilfen wie Screenreader oder Sprachausgabe lange hinaus zögern, weil sie psychologisch bedeuten, die eigene Sehbehinderung endgültig anzuerkennen. Genau diese Grauzone zwischen Sehen und Blindheit macht die Situation komplex und schwerer nachvollziehbar. Wer wirklich helfen möchte, sollte deshalb nicht vorschnell urteilen, sondern offen fragen, was gebraucht wird – denn die Bedürfnisse unterscheiden sich stark.
Welche typischen Barrieren begegnen Betroffene im digitalen Alltag noch?
Sehr häufig sind es einfache Dinge wie zu geringe Kontraste und Schriftarten, die beispielsweise verschnörkelt sind oder eine zu dünne Strichführung haben. Wenn Texte nicht ausreichend voneinander abgesetzt oder schlecht skalierbar sind, werden Webseiten für sehbehinderte Menschen nahezu unlesbar – auch wenn Screenreader oder Vergrößerungen genutzt werden.
Wie sieht es im beruflichen Kontext aus? Wo fehlen digitale Lösungen noch am dringendsten, um echte Chancengleichheit für blinde und sehbehinderte Arbeitnehmer zu schaffen?
Software muss von Anfang an barrierefrei entwickelt werden – ohne Ausreden. Screenreader-Kompatibilität, geeignete Schriftarten und anpassbare Kontraste sollten Grundstandards sein. Besonders im beruflichen Umfeld, wo effizientes Arbeiten zählt, erschweren schlecht designte Programme die Teilhabe massiv. Das Argument, Barrierefreiheit betreffe nur eine „kleine Gruppe“, ist längst überholt: Mit zunehmendem Alter wächst die Zahl der Sehbeeinträchtigten stark. Positivbeispiel bleibt das iPhone, das mit universellem Design zeigt: Ein Gerät kann für alle nutzbar sein. Solche konsequenten Standards bräuchten wir auch in Business-Software – das wäre nicht nur Inklusion, sondern schlicht modernes Produktdesign.
Was können wir alle schon heute tun, um ein Stück mehr digitale Barrierefreiheit im Alltag zu ermöglichen?
Wesentlich ist ein stärkeres Bewusstsein: Die meisten sehbehinderten Menschen sind nicht vollständig blind, und gerade im Alter wächst die Zahl der Betroffenen stetig. Die Politik muss klare Regeln mit spürbaren Sanktionen schaffen, wenn Barrierefreiheit nicht umgesetzt wird – sonst bleibt sie ein Lippenbekenntnis. Aber auch wir alle können beitragen: durch Offenheit, weniger Vorurteile und mehr Sensibilität. Wer erlebt, dass jemand mit Langstock einmal ein Handy liest oder ohne Stock unterwegs ist, sollte nicht vorschnell urteilen, sondern verstehen, dass Sehbehinderung viele Formen hat. Wenn dieses Bewusstsein stärker in Medien, Alltag und Arbeitswelt ankommt, ist schon viel gewonnen. Barrierefreiheit beginnt nicht erst mit Gesetzen, sondern im Kopf.
Wenn die Augen schwächer werden … Aufklärung, Beratung und Unterstützung
Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) ist eine Selbsthilfeorganisation mit dem Ziel, die Lebenssituation der Augenpatientinnen und -patienten sowie der blinden und sehbehinderten Menschen in Deutschland nachhaltig zu verbessern. Der Verband und seine Landesvereine bieten bundesweit Beratung an, insbesondere zu sozialrechtlichen Fragen und zur Rehabilitation bei Sehverlust, und haben dafür das qualitätsgesicherte Beratungsangebot „Blickpunkt Auge – Rat und Hilfe bei Sehverlust“ aufgebaut. Der DBSV verfügt zudem über ein umfangreiches Netzwerk von Einrichtungen und Organisationen, die dem Verband als Korporative Mitglieder angehören. Zahlreiche spezialisierte Fachdienste und Einrichtungen unterstützen im Berufsleben, beraten zu Hilfsmitteln, verleihen Hörbücher, bieten Veranstaltungen, Erholungsreisen und Kurse zur Bewältigung des Alltags wie auch zur Verbesserung der Mobilität.
Blickpunkt Auge – Rat und Hilfe bei Sehverlust
www.blickpunkt-auge.de